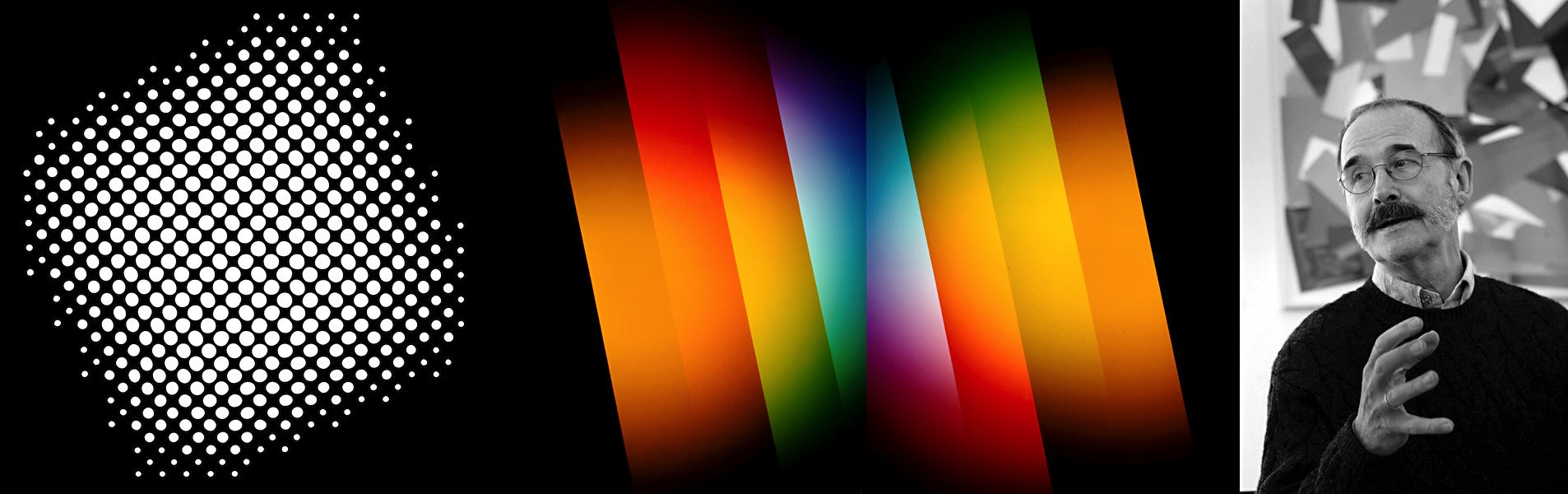
Texte von Gottfried Jäger
English | DeutschArtikel
Gottfried Jäger: Konkrete Fotografie
Publiziert in: Gottfried Jäger, Rolf H. Krauss, Beate Reese, Concrete Photography/Konkrete Fotografie, Bielefeld 2005.
I. Credo
Konkrete Fotografie bedeutet: Konkretisierung der Fotografie, eine Art elementarer künstlerischer Selbstbetrachtung und Selbstreflexion mit dem Ziel, den Blick für die eigenen Verhältnisse zu schärfen. Dabei werden die fotografischen Mittel zum fotografischen Gegenstand, das Medium zum Objekt.
Konkrete Fotografie ist ein Teilgebiet der Fotografie, so wie Dokumentarische, Inszenierende oder Experimentelle Fotografie Teilgebiete der Fotografie sind. Konkrete Fotografie ist zugleich Teilgebiet der Konkreten Kunst, so wie Konkrete Malerei, Konkrete Musik, Konkrete Poesie oder der Konkrete Film Teilgebiete der Konkreten Kunst sind. Konkrete Fotografie ist eine Kunstform des 20. Jahrhunderts. Ihre Entwicklung beginnt um 1900 und wirkt bis heute fort.
Ihre Werke sind reine Fotografie: Nicht Abstraktionen von Wirklichkeit, sondern Konkretionen von in der Fotografie enthaltenen bildnerischen Möglichkeiten. Konkrete Fotografien verwenden ausschließlich die elementaren und ureigensten Mittel des Faches, in erster Linie Licht und lichtempfindliches Material. Ihre Werke sind selbstbezüglich, selbstreferenziell, eigendynamisch, universell. Sie beziehen sich nur auf sich selbst und sind ausschließlich auf die eigenen, durch sie selbst geschaffenen innerbildlichen Verhältnisse gerichtet. Insofern sind sie allgemein verständlich. Sie vertreten keine außerbildliche Realität.
Unter Verzicht auf jede Ikonik und Symbolik, d. h. auf jede Form feststellbarer Ähnlichkeit gegenüber einem außerbildlichen Gegenstand und auf jede Form gedanklicher Entsprechung gegenüber einem außerbildlichen Sinn, äußert sich Konkrete Fotografie durch reine, fotoeigene, fotografisch hervorgerufene, ‚fotogene’ Syntax. Konkrete Fotografie ist ein Projekt der formalen Ästhetik.
Konkrete Fotografien sind nicht semantisches Medium, sondern ästhetisches Objekt, nicht Repräsentat, sondern Präsentat, nicht Reprodukt, sondern Produkt. Sie sind Gegenstände aus fotografischem Material. Sie wollen nichts abbilden und nichts darstellen. Sie sind nichts, das sie nicht selber sind: Objekte, die auf sich beruhen, eigenständig, authentisch, autonom, autogen: Fotografien der Fotografie.
Indem sie das Fotografische verabsolutieren und alles Nichtfotografische ausschließen, entdecken konkrete Fotografien die grundlegenden Möglichkeiten des Fotografischen zu jeder Zeit neu. Das ist ihre Aufgabe und ihr Sinn. Sie interpretieren diese Möglichkeiten und erweitern sie zugleich. Ihr Kriterium ist Innovation, die Erneuerung von Form und Struktur. Sie schaffen eine neue Welt. Sie sind nicht Abstraktionen von Etwas, sondern sie konkretisieren Etwas, etwas Neues. Ihr Augenmerk ist auf das Eigenbild gerichtet, auf sein geistiges Konzept, auf seinen künstlerischen Entwurf, auf seine bildnerische Kraft und seine materiale Realisation. Ihr Mittelbezug ist evident. Es geht nicht um Objektbezug, nicht Subjektbezug, sondern Mittelbezug, um Innenbilder der Fotografie.
Konkrete Fotografien sind narzistisch und egozentrisch, sie sehen nur sich selbst: Absolute Fotografien. Auch dieser Begriff käme für unsere Überlegungen in Betracht, denn auch er bedeutet etwas Grundlegendes, Letztendliches. Konkrete Fotografien sind auch: Reine Fotografien, Fotografien ‚an sich’, Fotos ohne Vermittlungsfunktion, ohne externe Botschaft. Sie existieren um ihrer selbst willen und enthalten keine ‚Message’, die über das hinausginge, was nicht auf ihren Oberflächen und in ihren Ordnungen unmittelbar zu sehen und zu erkennen wäre. Sie sind Botschaft. Fotografie kommt hier ‚zu sich selber’, sie tut was sie will, nicht was sie soll, sie hat sich von dienenden Aufgaben der Vermittlung befreit.
Gegenstand des konkreten Fotos ist allein sein eigenes, in ihm selbst ruhendes formales Gesetz. Der Gedanke hatte sich in den nicht-fotografischen Künsten bereits im frühen 20. Jahrhundert entwickelt und realisiert. Nicht so in der Fotografie – von Einzelfällen abgesehen. Das Foto verharrte noch in seiner Vermittlungsfunktion. Als autonomes Bild wurde es damals längst nicht wahr genommen. Jedenfalls längst nicht in dem Maße, als dass sich ein derartiger Anspruch hätte durchsetzen können. Im Gegenteil: Konkrete, nur auf sich selbst bezogene Fotografien, wie sie vereinzelt im Rahmen der Experimentalfotografie, so am Bauhaus, in Erscheinung traten, galten Vielen als Spielerei. Sie galten als Regelverstoß, als Störfall, ja als Verrat an der Reinheit der Idee strikter Abbildungstreue. Mit den Worten konservativer Theoretiker waren sie „Pseudophotographien“ (PAWEK 1960, 96), in den Augen konventioneller Fotografen ausgesprochene Fehlentwicklungen. Sie galten als „zwielichtige Gattung: weder Kunst noch Fotografie“ (RENGER-PATZSCH 1960, 6). Man war sich ihrer Tragweite nicht bewusst.
Betrachtet man aber die ‚Störfälle’ im Zusammenhang und zieht eine historische Linie von Fall zu Fall, so wird im Rückblick eine Entwicklung erkennbar, die ebenso folgerichtig wie unabwendbar auf ein bestimmtes Ziel hin gerichtet erscheint, wobei sich der eingeschlagene Weg zusehends verbreitert und festigt. Er führt vom ursprünglichen Zentrum fort, um ein neues Zentrum zu bilden: eine andere Art Fotografie. Sie operiert mit neuen Zeichen und Zeichenbedeutungen und verdichtet sich um einen Kern zu einem eigenen System, das längst den Charakter einer universellen Bildsprache angenommen hat. Sie ist Ausdruck des menschlichen Schöpfungsdranges, der sich mit Abbildung und Darstellung der Welt, wie sie ist oder wie sie erscheint, nicht zufrieden gibt. Sondern der danach strebt, mit seinen Mitteln eine neue Welt zu schaffen. Das gilt auch für den Umgang mit Fotografie. In ihm kommt ein sich selbst erfüllendes Programm zum Ausdruck, das von innen nach außen drängt: nämlich dazu, von allen Diensten freie, autonome Werke zu schaffen und sich von kontingenten Aufgaben und Eigenschaften des Mediums zu lösen.
So gesehen, erweist sich das Konkrete Foto als eine genetisch notwendige Form fotografischer Selbstbehauptung, Selbstbetrachtung und Selbstdarstellung, als eine Art Selbstvergewisserung auch, als Reflex eines zunehmend selbstbewussten, manchmal selbstverliebten und selbstvergessenen, aber auch selbstkritischen Blicks in den eigenen Spiegel. Ästhetik, Ethik und Logik konkreter Fotografien, die Qualität ihrer Schönheit, Güte und Wahrheit liegt in ihnen selbst begründet und sollte sich aus ihren Werken unmittelbar erkennen lassen, aus ihrem Dasein, ihrem Auftritt, ihrer Geschichte. Konkrete Fotografien sind autopoietisch, Selbstbildnisse der Fotografie.
II. Begriff
Dass sich der Begriff ‚Konkrete Fotografie’ erst heute, mehr als siebzig Jahre nach dem Manifest zur Konkreten Kunst von Theo van Doesburg (van Doesburg 1930) exponiert, sollte nicht verwundern. Allgemein ist das Foto als Kunstform erst spät erkannt worden. Erst seit 1985 gilt es als ‚Werk’ der persönlichen geistigen Schöpfung im deutschen Urheberrecht und ist damit Werken anderer Künste rechtlich gleichgestellt (Engelhard 1985; Ricke 1998). Ein nachhaltiges Bewusstsein für seine Bildleistungen und seine immense Vielfalt entwickelte sich erst mit der Akademisierung der Fotografie als Hochschulfach in Deutschland ab Anfang der 1970er Jahre (Jäger 2003). Dabei ging es um wissenschaftliche Begriffs- und Theoriebildung, um den Nachweis einer eigenen Fotogeschichte sowie um die experimentelle Erkundung neuer Bildinhalte und –formen. Der Aufstieg des Fotos durch die Hierarchien und etablierten Stätten der Kunst war damit unaufhaltsam geworden, dennoch mühsam. Fotos galten hier als Eindringlinge und ‚illegitime Kunst’ (Bourdieu 1981), insbesondere ihre abstrakten und konkreten Ambitionen. Sie waren auch politisch umstritten, in totalitären Systemen verfemt. Im ‚Dritten Reich’ galten sie als entartet. In der DDR wurden sie als ‚formalistisch’ diffamiert und ausgegrenzt. Kapitalistische Systeme reagieren marktbedingt: nicht eben abweisend, aber auch nicht gerade aufgeschlossen, wie sich erweist.
Das Eintreten für Begriff und Praxis einer Konkreten Fotografie zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine Folge von Erkenntnissen der jüngsten Zeit. Erst im Rückblick wurde erkannt, dass ein entsprechendes Gebiet in Geschichte und Gegenwart tatsächlich existiert, ein Gebiet, für das es keinen besseren Ausdruck gibt. Aber: ‚Konkrete Fotografie’ wird hier erst eigentlich etabliert. Dies ist die erste umfassendere Publikation zu dem Thema. Ob sich der Doppelbegriff durchsetzt, ob er als operationaler Begriff gebraucht und angewendet wird, bleibt offen. Der Umgang mit ihm ist jedenfalls völlig ungeübt, wie sich allenthalben zeigt. Vielleicht ist es auch bezeichnend, dass konkrete Fotografien in Form von Ausstellungen und Publikationen erst jetzt, in der Krise des Mediums Fotografie, also im Zeitalter ihrer digitalen Verfügbarkeit auf der Suche nach dem verlorenen Bild, nach seinen Wurzeln in Erscheinung tritt und zur Geltung kommt. Jedenfalls hat die Praxis der Konkreten Fotografie Spezifika entstehen lassen, die das Gebiet als eigenes Fach der Fotografie wie das der Künste ausweist und die es von seinen Nachbargebieten abgrenzt und unterscheidet. Es verfügt über eine Geschichte, die ihresgleichen sucht. Es hat Bildleistungen erbracht, die neue Sehweisen entstehen ließen und die damit Fotografiegeschichte und Kunstgeschichte bereichert haben, zeitgenössische Aktivitäten eingeschlossen.
Konkrete Fotografien rufen eine neue Einstellung des Betrachters dem Foto gegenüber hervor. Der Kamerablick auf die Welt ‚da draussen’ wendet sich um auf die Welt ‚da drinnen’, in die Kamera hinein. Der Apparat wird jetzt als eigene Welt entdeckt. Konkrete Fotografien untersuchen das Bildsystem auf ihre Art, zerlegen und dekonstruieren es und dringen zu seinen Elementen und Bauplänen vor. Aus ihnen werden neue Bildsysteme konstruiert. Prozesse der visuellen Analyse und Synthese werden zum Thema. Das Wie rückt in den Mittelpunkt, das Was und Wer treten zurück. Konkrete Fotografien vermitteln nicht die objektive Außenwelt, nicht den subjektiven Zustand, sondern die Wirklichkeit des Bildes (Brandt 1999); es geht ihnen nicht um Sichtbarmachung, nicht um Sichtweisen, sondern um Sichtbarkeit (Wiesing 1997).
Auch ein neuer Interessenkreis entsteht unter diesen Vorzeichen. Museen, Galerien, Sammlungen, Archive, Auktionshäuser und Hochschulen spezialisieren sich auf Teilgebiete
der Fotografie, z. B. experimentelle, subjektive oder generative Positionen (Schneider- Henn 2003; Lempertz 2003). Ein signifikantes Beispiel dafür ist die Sammlung Peter C. Ruppert – Konkrete Kunst in Europa nach 1945 im Museum im Kulturspeicher Würzburg mit ihrer Abteilung Konkrete Fotografie, der ersten musealen Manifestation dieses Begriffs (Lauter 2002). Eine neue und aktive Künstlerszene in Europa und den USA betrachtet das Verschwinden der Gegenstände aus der Fotografie (Faber 1992) nicht als Verlust, sondern als Gewinn an Freiheit und als Ausgangspunkt für neue Orientierungen – und Fragen: Was ist Fotografie? Was macht ihren Sinn und ihre Wirkung eigentlich (noch) aus, wenn das Foto auf Abbildung und Symbolwirkung total verzichtet? Was wird auf diese Weise gewonnen, was geht verloren?
Überlegungen dieser Art waren auch Gegenstand eines Projektes, das dieser Publikation vorausging: Abstrakte Fotografie: Die Sichtbarkeit des Bildes, Ausstellung und Symposium in Bielefeld (Kellein, Lampe 2000; Jäger 2002). Der Ansatz war dem hier zu Grunde liegenden ähnlich: Abstrakte Fotografie weist eine reiche Praxis nach, aber es existieren keine Theorie, Begrifflichkeit und Geschichtsdarstellung, die das Gebiet hätten erschließen können. Inzwischen liegen Publikationen dazu vor. Sie behandeln die Konkrete Fotografie noch als ein besonderes Teilgebiet im weiten Spektrum fotografischer Abstraktionen – eine diskussionswürdige Betrachtung, wie sich erwies.
Denn bekanntlich weisen beide Verfahren, Abstraktion und Konkretion, nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch grundlegende Unterschiede auf. In der Kunstgeschichte ist die Konkretion (der Werke) aus der Abstraktion (der Natur) hervorgegangen. So galten Abstraktion und Naturanlehnung durch die Konkretion des Bildes als historisch ‚überwunden’. Anschauliches Beispiel dafür ist die künstlerische Entwicklung des Malers Piet Mondrian (1872–1942). In den Jahren 1912 bis 1917 gelangte er von der gegenständlichen Landschaftsmalerei über Baumstudien zu immer abstrakteren Ausschnitten von Baumgeäst, woraus sich schließlich seine geometrischen und aus wenigen Grundfarben bestehenden eigenständigen ‚konkreten’ Kompositionen entwickelten (Haftmann 1955, 187ff.).
Abstraktion und Konkretion sind kognitive Methoden, Erkenntnismittel. Abstraktion verfährt reduktiv. Sie geht von einer komplexen Situation aus und gelangt durch zunehmendes Weglassen nicht wesentlicher Elemente zu den wesentlichen Elementen, zur ‚reinen’ Erkenntnis. Konkretion verfährt induktiv. Sie beginnt bei ‚Null’, bei einer Idee, bei einem Element, das sie mit anderen durch Regeln verknüpft, um so eine neue komplexe Situation oder ein neues System zu schaffen. Man könnte sagen: Abstraktion wandelt Materie in Geist (abstrahiert und idealisiert ein Objekt), Konkretion wandelt Geist in Materie (konkretisiert und objektiviert eine Idee). Abstrakte Fotografie idealisiert ein Objekt, Konkrete Fotografie objektiviert eine Idee. Es sind Transformationsprozesse dieser Art, die die eigentlichen ‚Gegenstände’ abstrakter und konkreter Fotografie bilden.
Ein anschauliches Beispiel für Ähnlichkeit und Differenz beider Methoden bietet vielleicht die Mikrofotografie. Sie abstrahiert ihre Objekte durch Nahsicht und Ausschnitt von ihren Zusammenhängen soweit, dass sie schließlich eine Eigenwelt bilden. Sie können zu autonomen Zeichen ihrer selbst werden, wobei ihre Herkunft u. U. völlig in Vergessenheit gerät (Strüwe 1955; Abb. S. xxx).
Konkrete Fotografien streben eine andere Art Wahrheit, Schönheit und Güte an und erreichen ihre Maximen mit anderen Mitteln als gegenständliche oder symbolische
Fotografien. Ihre Logik, Ästhetik und Ethik folgt eigenen Gesetzen. Sie verweisen auf die Grundstrukturen des Bildes, machen sie sichtbar und nähren die gestellte Frage, was Fotografie im Grunde (noch) sei? Und damit auch: Was Fotografie künftig sein könnte, wenn sich die bisher so verlässlich erscheinenden analogen Grundsätze von Ursache und Wirkung zwischen Licht und lichtempfindlichen Material ins Digitale verflüchtigen und darin auf- oder unterzugehen beginnen und nur ein ‚Photo-Image’ übrig bleibt von dem einst so bedeutenden dokumentarischen, realistischen und bildberichterstattenden Fach. Vielleicht rettet ausgerechnet Konkrete Fotografie letzte Reste des Authentischen der Fotografie, nachdem ihre ehemals so hoch geachtete Gegenständlichkeit ihren Geist im Rechner völlig aufgegeben hat.
Dabei war die Abbildungstreue einmal der zentrale Begriff des Mediums, ein technisch- moralischer Ausdruck für Das Versprechen der Fotografie (Groys 1998), ihren Gegenständen „in Wahrheit und Treue“ zu dienen. Der Ausdruck erinnert an das hohe Gut – Realismus und Beweiskraft – das die Fotografie von ihren Anfängen bis heute so besonders ausgezeichnet hat. Auf dieser Basis entstand die Gattung der fotografischen Abbilder mit zahlreichen Arten und Unterarten, deren gemeinsame Wirkung auf dem Wiedererkennungswert beruht. Er beweist sich durch die feststellbare Ähnlichkeit des Bildes gegenüber dem Abgebildeten. Zeichentheoretisch handelt es sich um Ikone.
Aber Abbildungstreue und Wiedererkennungwert blieben nicht die einzigen Bildqualitäten des Fotos. Als gleich bedeutend muss seine mit der Zeit zunehmend erkannte und anerkannte Fähigkeit zur Darstellung gelten. Es kann auch Ausdruck menschlicher Vorstellungen und Fantasien sein, ein Sinnbild, eine Bild gewordene Entsprechung abstrakter Gedanken, Visionen und Träume. Alfred Stieglitz (1864–1946) führte für Fotografien dieser Art die Bezeichnung Equivalents ein. So nannte er eine Reihe von Aufnahmen von unregelmäßigen Wolkenformationen um 1929, die er als bildliche Entsprechungen zu seinen damaligen Gemütszuständen betrachtete. „... the ‚Equivalents’ are his autobiography“, soweit sogar ging seine Biografin Doris Bry später (Bry 1965, 19). Tatsächlich beruht die Sinnbildfunktion von Fotografien auf einer begrifflichen Zuschreibung, nämlich zu dem, was auf dem Foto zu sehen ist. Eine gewisse kulturelle Übereinkunft zwischen Bildgeber und Bildnehmer ist aber Voraussetzung für ihre Handhabung und ihren Erfolg. Die Semiotik nennt Zeichen dieser Art Symbole.
Eine dritte Gattung nennen wir Strukturbilder (Schmoll 1979; Jäger 1991, 2002). Ihre Reinform ist: Konkrete Fotografie. Diese stellt aber nicht die einzige Bildart der Gattung der Strukturbilder dar, sondern in ihr sind auch andere struktur-erzeugende Bildarten aufgehoben, wie die Abstrakte, Experimentelle, Serielle, Konstruktive oder in Teilen auch Konzeptuelle Fotografie, auch einzelne visualistische Projekte der 1970er Jahre kann man zu den fotografischen Strukturbildern zählen. Ihnen gemeinsam ist ihre strukturbildende Absicht. Der Strukturbildungsprozess überlagert alle anderen Ambitionen. Strukturbilder zielen, wie konkrete Fotografien auch, auf das autonome Bild. Die Zeichentheorie nennt sie Symptome, Spuren.
Die semiotische Fachliteratur nennt sie auch Indizes oder indexikalische Zeichen (Brög 1977; Nöth 2003). Denn sie zeigen etwas an – ohne dass diesem Etwas (zunächst) etwas Bekanntes anhaftet, ihm ähnlich oder äquivalent wäre. Sie sind Anzeichen, sonst nichts, Hinweise auf einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Realität und Erscheinung. Insofern sind Strukturbilder Symptomen in der Medizin oder Indizien in der Kriminalistik vergleichbar. Sie müssen als Zeichen erkannt und diagnostiziert, ihre Spur muss gesichert
und ihre Bedeutung indexikalisch festgelegt werden. Ohne Zeichenerklärung sind sie nicht zu entschlüsseln. So erscheinen auch konkrete Fotografien zunächst unbedeutend, fremd, ohne eigentlichen Inhalt. Aber sie sind auch nicht nichts. Denn unübersehbar verweisen sie auf einen außergewöhnlichen Zusammenhang, einen ambitionierten Umgang mit dem fotografischen Prozess und – nicht zuletzt – auf die Anwesenheit des Menschen.
In ihrer reinsten Form sind Strukturbilder Objekte ihrer selbst. Insofern müssen sie nicht unter allen Umständen Zeichen sein. Sie haben in erster Linie Objekt-, erst in zweiter Linie Zeichencharakter. Erkennen wir sie aber als Zeichen, so sind sie ein Appell an unsere Fähigkeit zur Interpretation. So können sie zum Beispiel auf einen ‚anderen’, einen schöpferischen Umgang mit dem ursprünglich ganz auf Reproduktion hin ausgerichteten ‚Apparat’ verweisen. Ein hoffnungsvoller Gedanke, auf den bedeutende Protagonisten hingewiesen haben (Moholy-Nagy 1925; Flusser 1983).
III. Methode, Stil
Die Anfänge konkreter Fotografien waren durch das Experiment bestimmt, durch das ergebnisoffene Spiel mit neuen bildnerischen Mitteln. Alwin Langdon Coburn (1882– 1966) arbeitete 1917 in London mit Kamera und Optik, Prismen und Spiegeln. Im Bannkreis des englischen ‚Vortizismus’ schuf er so die ersten konkreten Fotografien. Er nannte sie Vortographs, Wirbelbilder (Steinorth 1998; Deppner 2002). Ein Jahr später entstanden als Spielerische Inventionen unter dem Einfluss der Dada-Bewegung in Zürich die ersten Fotogramme, kameralose Fotografien, von Christian Schad (1894–1982; Schad, Auer 1999). Offensichtlich bedeuteten sie ihm anfangs auch nicht viel mehr, sonst hätte er sie nicht „fast wie Bastarde weggegeben“ (Neusüss 1990); er bekam sie nie wieder zu Gesicht. Heute stellen die etwa dreißig kleinformatigen Bildchen wertvolle Inkunabeln der Fotografiegeschichte dar.
Später traten an die Stelle des spontanen Spiels empirische Methoden nach dem Prinzip von ‚Versuch und Irrtum’ bei der Anwendung der zunehmend bekannter werdenden Verfahren wie Luminogramm, Fotogramm, Negativkopie, Solarisation, usw. Auch neue Inhalte kamen hinzu. Für den Bauhauslehrer László Moholy-Nagy (1895–1946) war das Licht das zentrale Motiv. Er bezeichnete sich als ‚Lichtner’, der mit dem Licht malt. Er löste sich damit von Bindungen an das Pigment der Malerei, auch von den Bindungen des Fotos an seine bisherigen Gegenstände, ja selbst von der Kamera, so dass gegenstandsfreie kameralose Lichtbilder entstanden: „das wesentliche werkzeug des fotografischen verfahrens ist nicht die kamera, sondern die lichtempfindliche schicht“ (Moholy-Nagy 1978, 75). Hier, in der fotografischen Emulsion fand sein ‚Gegenstand’, das Immaterielle und Flüchtige elektromagnetischer Strahlen, seinen direkten, unmittelbaren und objektiven Niederschlag. Als ‚Licht-Emanationen’ bezeichnete sie später der deutsche Kunsthistoriker Franz Roh (1880–1965), der auf diesem Gebiet selbst praktizierte (Roh 1964, 11). Ab 1937 entwickelte Nathan Lerner im Fotografieunterricht von Henry Holmes Smith (1909– 1986) am New Bauhaus in Chicago die ‚Light Box’, einen mit Löchern und Schlitzen versehenen und mit Fotopapier bestückten beweglichen Kasten, der, nachdem er von außen dem Licht ausgesetzt und dabei bewegt und das Papier entwickelt worden war, zufallsbedingte und überraschend bildwirksame Ergebnisse sichtbar werden ließ. 1971 unternahm der deutsche Fotograf Timm Rautert ähnliche Versuche im Rahmen seiner bildanalytischen Studien (Rautert 2000; Abb. S. xxx).
Die wenigen Beispiele sollen zeigen, dass Entstehung und Erscheinung konkreter Fotografien ursächlich mit technischen Prozessen verbunden sind. Ihre Mittel und Methoden bestimmen das Aussehen der Bilder. Daher sind diese Prozesse in die Beurteilung einer kreativen Leistung mit einzubeziehen. Das legen u. a. die zahlreichen Experimente mit selbst entwickelten Camera-obscura-Systemen in jüngerer Zeit nahe: Die ‚Apparate’ sind oft ebenso sehens- und bemerkenswert, wie die Bilder, die durch sie entstanden sind. Konkrete Fotografien sind prozessorientiert. Sie zielen weniger auf ein bestimmtes, vorher festgelegtes Ergebnis. Sondern sie operieren ergebnisoffen mit neuen Mitteln und Methoden, dem experimentierenden Forscher vergleichbar, der schrittweise vorgeht und bis zuletzt gespannt auf die sichtbaren Resultate seiner Versuche wartet.
Das zeigt sich auch in den Werken der ‚konkreten’ tschechoslowakischen Fotoavantgarde der Zwischenkriegszeit, die eine reiche Skala bildnerischer Innovationen hervorgebracht hat – allerdings unter anderen als den ‚klassischen’ Vorzeichen der Konkreten. Ihre Vertreter gingen weniger geplant als intuitiv vor, sie standen surrealistischen Prinzipen nah. Doch sie operierten in strukturbildender Absicht und ihre Werke verzichteten auf figurative, gegenständliche und symbolische Zeichen (Birgus 1999, 2002). Heute werden sie wieder entdeckt und gewürdigt, wie z. B. aktuell Jaroslav Rössler (1902–1990; Langer 2004; Abb. S. xx, xx). Als Beispiel für ihre unkonventionellen Praktiken im Umgang mit dem fotografischen Material sei nur der Tscheche Milos Korecek (1908–1989) erwähnt. Er erfand durch ‚Zufall’ ein neues Verfahren, dessen Ergebnisse er 1947 ‚Fokalke’ nannte. Der Ausdruck war eine Ableitung von dem der ‚Dekalkomanie’, einer von Oscar Dominguez 1935 eingeführten surrealistischen Verfahren (Jaguer 1982), das auf dem Abrieb noch feuchter Farbe zwischen zwei Papieren beruht, der grafischen Frottage vergleichbar. Korecek benutzte alte Fotoplatten, die er einweichte, erhitzte und weiteren Torturen aussetzte, und die nach dem Kopiervorgang zu eigenartigen, pseudoräumlich wirksamen Bildstrukturen führten (Abb. S. Xxx).
Eine breite Palette lichtgrafischer Techniken mit Mehrfachbelichtung, ‚Diaphaner Collage’ und ‚Luzidogramm’ entwickelte auch der deutsche Experimentalfotograf Heinz Hajek- Halke (1898–1983), ein außergewöhnlicher Bilderfinder und Kunstingenieur, der Phantasie und technisches Kalkül kompositorisch überzeugend zu verbinden wusste. Auch seine Werke erfahren erst heute breitere Beachtung und Anerkennung. Für ihn waren Begriff und Praxis des ‚gelenkten Zufalls’ bestimmend (Hajek-Halke 1955, 1964). Seine Ergebnisse beruhen auf jahrelanger experimenteller Erfahrung mit chemischen und optischen Mitteln und Methoden: mit doppelbrechenden Kristallen im polarisierten Licht, mit Leimresten und Schlierenoptik. Er akzeptierte den Zufall als schöpferische Instanz und einen gewissen Selbstvollzug des von ihm eingerichteten bildgebenden Systems. Damit stehen auch seine Werke dem surrealistischen Prinzip nahe, dem des ‚automatischen Schreibens’ unter Beteiligung des optisch Unbewussten am bildschöpferischen Prozess.
Weniger zufällig, ja in bewusster Abwendung von jeder surrealistischen Metaphysik erweisen sich demgegenüber die Konstruktiven Konzepte (Rotzler 1977, 1991) der Moderne, auch die der Fotografie. Exemplarisch dafür sind die Arbeiten einer damals jungen Schweizer Avantgarde um Roger Humbert, Jean Frédéric Schnyder, Rolf Schroeter und René Mächler. 1960 hatte die Basler Ausstellung Ungegenständliche Photographie (Hernandez 1960) ihre Arbeiten mit Werken der subjektiven fotografie vereinigt. Ebenso die Fotonummer 8 (1960) der programmatischen internationalen zeitschrift für konkrete kunst und gestaltung ‚spirale’ (Bucher 1990). 1967 dann zeigten die genannten Vier ihre Arbeiten in der Berner galerie actuelle unter dem Titel
Photographie concrète (Rouiller 1967), dem m. W. ersten öffentlichen Auftritt dieses Doppelbegriffs. Die erste europäische Galerie für Fotografie, die Galerie form in Zürich, und kurz darauf auch die erste deutsche Fotogalerie, die Galerie Clarissa in, waren von etwa 1966 bis 1969 als regelrechte Tendenzgalerien ausgesprochene Zentren für die konkrete europäische Fotografie jener Zeit, insbesondere für deren konstruktive Richtung (Clarissa 1968). Letztere förderte auch die Beziehungen zwischen den ‚generativen’ Avantgarden der Fotografie und Computerkunst (Franke, Jäger 1973), und sie erweist sich damit als wichtiger Standort für die Anfänge der apparativen Kunst jener Zeit (Piehler 2002).
Konkrete Fotografie wurde eingangs als ‚reine Fotografie’ gekennzeichnet, frei von figurativen oder symbolischen Zeichen, realisiert aus Licht und lichtempfindlichem Material. Dies ist zunächst nichts als die Beschreibung einer künstlerischen Methode, nicht eines Stils. Sie orientiert sich am Manifest der konkreten Kunst von Theo van Doesburg: „Ein Bildelement bedeutet nichts anderes als ‚sich selbst’...“ (van Doesburg 1930). Aber mit seiner ebenfalls darin erhobenen Forderung, dass „Die Konstruktion des Gemäldes und seiner Elemente“ einfach und visuell überprüfbar, dass seine Technik mechanisch, exakt und „anti-impressionistisch“ und das Werk im „Streben nach absoluter Klarheit“ gipfeln müsse, formuliert der Verfasser auch entscheidende stilistische Merkmale dieser Kunst. Er verknüpft das Methodische konkreter mit dem Stilistischen konstruktiver Kunst. Dabei ist es bis heute geblieben. Bezeichnend dafür ist der häufig auftretende Doppelbegriff dieser Kunst: ‚konkret-konstruktiv’. Er besagt aber auch, dass beide Begriffsinhalte nicht kongruent sind. Max Bill (1908–19xx) verbindet sie in geschickt offener Weise: „Konstruktive Kunst“, so sagt er, „ist jener Teil der konkreten Kunst, der sich systematisch- konstruktiver Mittel bedient“ (Bill 1978). Daraus folgt, dass Konkrete Kunst auch andere als ‚konstruktive’ Werke hervorbringen könnte – und kann, wie sich am Beispiel der tschechischen Fotoavantgarde zeigt. Ihre Vertreter arbeiten ‚konkret’ in dem Sinne, dass ihre Werke nur ‚sich selbst’ bedeuten und aus ihren eigenen Mitteln und Gesetzen heraus entstanden sind. Aber sie arbeiten nicht konstruktiv, analytisch, methodisch, sondern experimentell, intuitiv, spontan.
Ich empfehle daher, mit Begriff und Realität konkreter Fotografie künftig eher undogmatisch und ideologiefrei umzugehen und beide nicht nominalistisch auf die historischen Ursprünge der konkreten Kunst hin festzulegen – zumal sie sich auf ein anderes Fach, die Malerei, beziehen. Sondern man sollte beiden im Rahmens von Eigengesetzlichkeit und Selbstreferenz alle Möglichkeiten stilistischer Formfindung offen halten. Konkrete Fotografie wird so zu einem übergeordneten, zu einem Methodenbegriff, nicht Stilbegriff, zu einem Begriff, der auch anders als ‚konstruktiv’ gehandhabt werden kann. Andernfalls müsste man ja auf wesentliche Eigenschaften des Fotografischen verzichten: auf Chaos und Schatten, auf Störung und Staub, auf Verfall und Tod, auf das Dionysische gegenüber dem Apollinischen einer Fotografie, die auch noch in der Konkretion ihres Verschwindens neue Belebung erfährt.
Konkrete Fotografie ist demnach nichts als eine eigengesetzliche, eigendynamische, selbstreferenzielle, selbstreflexive, d. h. ganz auf sich selbst bezogene fotografische Kunst, eine Gattung, die exakte Zahl, Regel und System ebenso in sich einschließt wie Geste, Spontaneität und Zufall. Sie ist nicht nur eine Kunst, die mit, sondern auch gegen den Apparat spielt! Die Arbeiten der Tschechischen Avantgarde der 1920er, 1930er Jahre und die aktuellen Arbeiten des deutschen Performers Ralf Filges mit
seinen Fließbildern und Pyrogrammen mögen für die zuletzt genannte Position als Beispiele gelten (Jäger 2004, 192ff; Abb. S. xxx–xxx).
Demgegenüber verkörpern die Arbeiten der Generativen Fotografie radikal konstruktive Positionen. Sie stellen einen Syntheseversuch aus exakter Ästhetik und Fotografie dar und sind auch als Reaktion auf die in den 1950er und 1960er Jahren dominierenden fotografischen Bewegungen subjektive fotografie (Steinert 1951) und Totale Photographie (Pawek 1960) in Westdeutschland entstanden, denen sie eine neue konkrete fotografische Bildsprache, frei von Realismus und Symbolismus, entgegensetzten. Wegweisend für die generative Idee war hier das Buch Kunst und Konstruktion von Herbert W. Franke, der darin die rationale Welt von Physik und Mathematik mit dem fotografischen Experiment subjektiver Prägung verband (Franke 1957). 1968 wurden entsprechende Arbeiten im Bielefelder Kunsthaus erstmals vorgestellt. Kilian Breier, Pierre Cordier, Hein Gravenhorst und der Verfasser dieses Beitrags, der auch den Begriff einführte, verzichteten in ihren Arbeiten auf jede Art der Wiedergabe außerbildlicher Realität und Symbolwirkung. Leitidee war die demokratische Teilhabe am Kunstprozess durch Transparenz und Nachvollziehbarkeit des künstlerischen Programms (Jäger 1968, 1973; Abb. S. xxx–xxx).
Die theoretische Basis bildete die Generative Ästhetik des damals in Stuttgart lehrenden Philosophen Max Bense (1910–1990). Sie zielte auf „die Erzeugung ästhetischer Zustände durch Zerlegung dieser Erzeugung in endlich viele unterscheidbare und beschreibbare Einzelschritte“ (Bense 1965). Der dabei entstehende Begriff einer Programmierung des Schönen (Bense 1960) konnte sich vor allem mit Hilfe exakter Technik erfüllen, so mit der der Foto- und Computergrafik (Nees 1969). Generative Fotografie ist also zugleich: Konkrete Fotografie und schließt jenen ihrer Teile ein, der sich systematisch-konstruktiver Mittel bedient. Insofern veranschaulichen generative Fotografien auch die Idee des künstlerischen Konstruktivismus, dem sie die numerische Programmsteuerung apparativer Systeme hinzufügten. Hierin ist ihr innovativer Beitrag für die Fotografie zu sehen. Durch ihn sind sie mit der modernen Computerwelt verbunden. Generative Fotografien bilden, so gesehen, nicht nur ein wichtiges Teilstück Auf dem Wege zur Computerkunst (Franke 2001, 172ff.), sondern sie bilden auch eine Brücke zwischen den Kulturen Kunst und Technik.
Als weitere Spielart konkreter Fotografie kommen Werke der Bildanalytischen Fotografie in Betracht, einer Unterart der Konzeptkunst der 1970er Jahre, die ihre eigenen Regeln und Gesetzmäßigkeiten thematisiert. In Fall der Fotografie geht es um Belichtungszeiten, Blendenwerte, Schärfe-Unschärfe-Relationen, den Umgang mit der Kamera, wie Kamerahaltung, Kamerabewegung, usw. Ihre Werke analysieren bestehende Verfahren und führen auch neue Regeln ein. Sie untersuchen die früher als technische Hilfsmittel benutzten Geräte, wie Stative, Kameras und Optiken auf ihren Objektcharakter hin. Das Zeigende (Medium) wird zum Gezeigten (Objekt). Beispiele dafür sind im Rahmen dieser Publikation die selbstbezüglichen Installationen von Jakob Mattner (Abb. S. xxx, xxx) und die bildanalytischen Fotoarbeiten des englischen Konzeptkünstlers John Hilliard (Abb. S. xxx, xxxf.).
IV. Epilog
Neue Arbeiten konkreter Fotografie können auf alle Erkenntnisse und Erfahrungen vergangener Zeiten zurückgreifen. Sie treten im Rahmen von Sammelausstellungen wie Abstraction in Contemporary Photography in den USA (De Sana 1989), Abstrakte Fotografie in Deutschland (Kellein, Lampe 2000), mit programmatischen Ausstellungs- und Buchtiteln wie Neuer Reduktionismus in Österreich (Horak 2002), Optic Nerve in England (Packe 2003) oder Un monde non-objectif en photographie (Herold 2003) in Frankreich oder mit umfangreichen Themenheften zu Abstracción der spanischen Zeitschrift EXIT (EXIT 2004) hervor. Gegenüber den frühen Arbeiten spielt die Farbe jetzt eine dominierende Rolle, so auch das imposante Format des Einzelbildes und die großzügige lichtmalerische Geste. Form und Gestaltung sind oft von elementaren Strukturen und fundamentale Konzepten bestimmt. Die neuen Bilder sind nicht mehr so kompliziert und verzwickt, wie etwa zu Zeiten der Konzeptkunst. Sie verlangen nicht unbedingt nach Erklärungen und Gebrauchsanweisungen für das Verständnis und das Sehen, sondern sie suchen die direkte, unmittelbare und überzeugende Bildwirkung, die einfach zugängliche und im besten Sinne des Wortes konkrete Bildsprache. Sie nehmen die historische Erfahrung ebenso in sich auf, wie sie sie in ihren aktuellen Produktionen auch zu überwinden trachten und hinter sich lassen. Dabei werden die einmaligen Formvorteile des Fotos überzeugend ausgespielt: Seine besondere Faktur, von der schon Moholy-Nagy schwärmte, sein Reichtum an Details und seine Feinteiligkeit, das Changieren und das Flimmern seiner chemischen Oberflächen, die eleganten Verläufe von Hell nach Dunkel, von Weiss nach Schwarz, die Glätte und die spiegelnde und schillernd farbige, ja unübertroffene Sättigung und Brillianz, aber auch: die Haptik, Rauhheit und Plastizität des Fotomaterials selbst, wenn man es gewähren lässt. Es wölbt sich zu plastischen Objekten auf, es widersetzt sich und springt aus dem Rahmen. Nicht zuletzt die Einbeziehung von allerlei Gerät aus dem fotografischen Fundus der Vergangenheit, wie Linsen, Kameras oder Stative, Gebrauchsanweisungen, Piktogramme oder Tabellen, einst unverzichtbare Mittel und Medien, lässt originelle, zuweilen humorvoll-ironische, auf das Foto und den Fotoprozess zurück verweisende Reflexionen entstehen. Es sind Bilder und Objekte, die bleiben werden und nicht im virtuellen Schein verschwinden, und die sich Gegen eine Ästhetik des Vergessens (Deppner 1995) stellen.
© 2025, Gottfried Jäger, Bielefeld